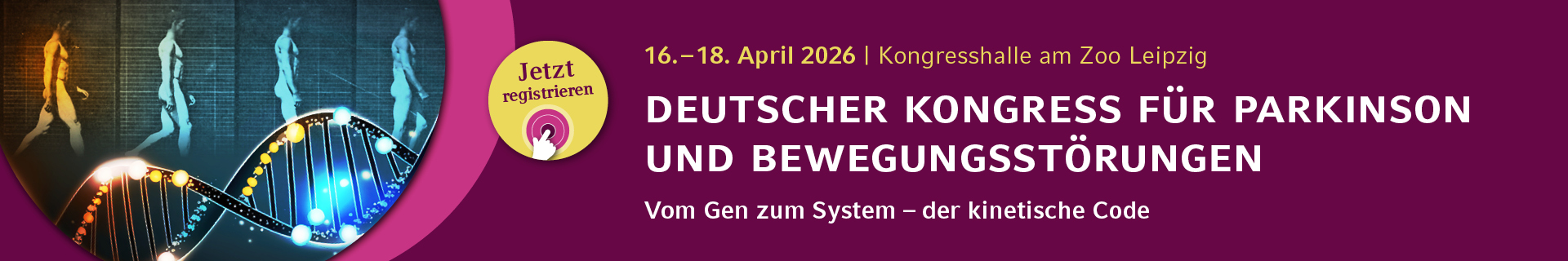Fachbeiträge
7. Hiltruper Parkinson-Tag
 Mehr als 70 Mitglieder des Forum für Parkinson und Bewegungsstörungen e.V. waren der Einladung von Dr. med. Wolfgang Kusch, Chefarzt der Neurologie am Herz-Jesu-Krankenhaus Münster-Hiltrup, zum 7. Hiltruper Parkinson-Tag in der Stadthalle Hiltrup gefolgt und machten sich mit Bus und PKW auf den Weg. Erstmals begleiteten Simone Heinike und Raphael Bertram vom Deutschen Roten Kreuz, Ortsverein Burgsteinfurt unsere Mitglieder. Hier die Beiträge des Tages
Mehr als 70 Mitglieder des Forum für Parkinson und Bewegungsstörungen e.V. waren der Einladung von Dr. med. Wolfgang Kusch, Chefarzt der Neurologie am Herz-Jesu-Krankenhaus Münster-Hiltrup, zum 7. Hiltruper Parkinson-Tag in der Stadthalle Hiltrup gefolgt und machten sich mit Bus und PKW auf den Weg. Erstmals begleiteten Simone Heinike und Raphael Bertram vom Deutschen Roten Kreuz, Ortsverein Burgsteinfurt unsere Mitglieder. Hier die Beiträge des Tages
→ Parkinsonnetz Münsterland, aktuelle Versorgungsrealität
(Powerpointpräsentation, 30 Seiten, PDF, 3,0 MB)
Michael Ohms → Ein Problem in der Behandlung mit Parkinsonmedikamenten
(Powerpointpräsentation, 21 Seiten, PDF, 0,3 MB)
Nadine Altfeld → Musiktherapie und Tanzen – Hilfe für Parkinsonpatienten oder Hype?
(Powerpointpräsentation, 21 Seiten, PDF, 0,3 MB)
Dr. Addali: Beckenbodenschwäche und Inkontinenz
 Was er als Urologe mit Parkinson zu tun habe, wollten Teilnehmer wissen, als Dr-Addali über die ausführliche Beratung, die vielfältigen Diagnose-Verfahren und umfassenden Therapie-Angebote des Kontinenz- und Beckenboden-Zentrums referiert. „Auch Parkinson-Erkrankte zählen zu meinen Patienten. Auf diese wollen wir ebenso individuell eingehen.“ Die Behandlung der komplexen und filigranen Beckenbodenregion erfordere einen sensiblen Umgang und höchste Professionalität, betonte der Spezialist. „Diesem Grundsatz verpflichtet steht unser interdisziplinäres Expertenteam mit Kompetenz, Erfahrung und menschlicher Nähe für die Gesundheit unserer Patienten ein.“
Was er als Urologe mit Parkinson zu tun habe, wollten Teilnehmer wissen, als Dr-Addali über die ausführliche Beratung, die vielfältigen Diagnose-Verfahren und umfassenden Therapie-Angebote des Kontinenz- und Beckenboden-Zentrums referiert. „Auch Parkinson-Erkrankte zählen zu meinen Patienten. Auf diese wollen wir ebenso individuell eingehen.“ Die Behandlung der komplexen und filigranen Beckenbodenregion erfordere einen sensiblen Umgang und höchste Professionalität, betonte der Spezialist. „Diesem Grundsatz verpflichtet steht unser interdisziplinäres Expertenteam mit Kompetenz, Erfahrung und menschlicher Nähe für die Gesundheit unserer Patienten ein.“
Dr. Mustapha Addali, Rekonstruktive Urologie und Uro-Gynäkologie St. Antonius-Hospital Gronau
→ Beckenbodenschwäche und Inkontinenz – Mit Kompetenz gegen ein Tabuthema
(Powerpointpräsentation, 38 Seiten, PDF, 2.3 MB)
Esther Grävemäter → Vorstellung St. Antoinus-Hospital
(Powerpointpräsentation, 21 Seiten, PDF, 2.1 MB)
Parkinsonnachmittag im UKM | 11-09-2019
 „Was gibt es Neues?“ hatten Professor Warnecke und sein Team den im Zweijahresrhythmus stattfindenden Parkinsonnachmittag am UKM überschrieben. So ging der Wissenschaftler unter anderem darauf ein, dass sich auf dem Gebiet der Medikamentösen Therapie die Bedeutung von L-Dopa sowohl für die Behandlung der Patienten als auch für die Parkinson-Forschung geändert habe. „Im Gegensatz zu früherer Meinung ist jetzt erwiesen, dass eine niedrigdosierte L-Dopa-Therapie frühzeitig begonnen werden kann.“ Ein weiterer Schwerpunkt war die Information rund um die Tiefe Hirnstimulation.
„Was gibt es Neues?“ hatten Professor Warnecke und sein Team den im Zweijahresrhythmus stattfindenden Parkinsonnachmittag am UKM überschrieben. So ging der Wissenschaftler unter anderem darauf ein, dass sich auf dem Gebiet der Medikamentösen Therapie die Bedeutung von L-Dopa sowohl für die Behandlung der Patienten als auch für die Parkinson-Forschung geändert habe. „Im Gegensatz zu früherer Meinung ist jetzt erwiesen, dass eine niedrigdosierte L-Dopa-Therapie frühzeitig begonnen werden kann.“ Ein weiterer Schwerpunkt war die Information rund um die Tiefe Hirnstimulation.
→ Tobias Warnecke: Neue Entwicklungen der Parkinson Therapie
(Powerpointpräsentation, 40 Seiten, PDF)
 Ein Parkinson-Patient schildert eindrücklich, dass er derzeit nur dank der ‚Tiefen Hirnstimulation‘ in der Lage ist, ein relativ normales Leben zu führen. „Bei meiner Untersuchung stellte sich schnell heraus, dass ich der ideale Patient dafür bin.“ Dass diese Methode leider nicht für jeden in Frage komme, betonen Warnecke und Zentsch. „Falls ja, sollten Betroffene nicht zu lange warten. Aber es bleibt eine individuelle Entscheidung“, so Zentsch, die detailliert erläutert, welche sogenannte Hirnschrittmacher es gibt, wann man sich operieren lassen sollte, wie so eine OP abläuft und welche Zukunftsperspektiven sich derzeit auf diesem Gebiet abzeichnen.
Ein Parkinson-Patient schildert eindrücklich, dass er derzeit nur dank der ‚Tiefen Hirnstimulation‘ in der Lage ist, ein relativ normales Leben zu führen. „Bei meiner Untersuchung stellte sich schnell heraus, dass ich der ideale Patient dafür bin.“ Dass diese Methode leider nicht für jeden in Frage komme, betonen Warnecke und Zentsch. „Falls ja, sollten Betroffene nicht zu lange warten. Aber es bleibt eine individuelle Entscheidung“, so Zentsch, die detailliert erläutert, welche sogenannte Hirnschrittmacher es gibt, wann man sich operieren lassen sollte, wie so eine OP abläuft und welche Zukunftsperspektiven sich derzeit auf diesem Gebiet abzeichnen.
→ Verena Zentsch: Neues zur Tiefen Hirnstimulation – Der Patient im Fokus!
(Powerpointpräsentation, 41 Seiten, PDF)
Einblicke in die Telemedizin
Unter dem Thema „Telemedizin – ein Beitrag zur Reduzierung räumlicher Disparitäten?“ stand das zweitätige Seminar der Konrad-Adenauer-Stiftung unter der Leitung von Dr. Mechthild Scholl, an dem die beiden Mitglieder des Forum für Parkinson und Bewegungsstörungen e.V. Hagen Libeau und Margret Hartwig, teilnahmen. Das Seminar lieferte spannende Einblicke in die Aspekte der Telemedizin. Mit bestem Dank an die Referenten geben wir hier die Inhalte in einen kurzen Überblick wieder.
- Telemedizin – Baustein (inter-) kommunaler Konzepte zum gesundheitlichen und pflegerischen Angebot in einer Region
- Projekt „elVi“, Elektronische Arztvisite – Ein Beitrag zur Verbesserung der medizinischen Versorgung in der Region Westfalen-Lippe
- Projektwerkstatt Gesundheit 4.0 – Zukunftsweisende Ansätze in der Telemedizin und der Vernetzung in der Gesundheitswirtschaft
- Der Telearzt: Ein telemedizinischer Beitrag zur Minderung von Versorgungsdisparitäten
- Sektorenübergreifende Versorgung älterer Menschen – das Projekt „OBERBERG_Fairsorgt“
Dr. med. Fechtrup: Bluthochdruck – Bedeutung & Erkennung
 Bluthochdruck ist die Todesursache Nr. 1 in Deutschland, er ist jeweils für rd. die Hälfte der Herzinfarkte und Schlaganfälle verantwortlich. Eine Früherkennung und rechtzeitige Behandlung sind daher sehr wichtig, hob Dr. med. Christian Fechtrup, Münster, Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Angiologie, FESC in seinem Vortrag zum Thema „Bluthochdruck“ hervor. Fast jeder Dritte ist von Bluthochdruck betroffen, dieser ist aber gut behandelbar. Unbehandelt kann er zu schweren Folgen führen: Herzerkrankungen, Nierenerkrankungen, Schlaganfall, Hirnerweichung, Netzhautschaden oder gar Erblindung. Auch die Lebenserwartung sinkt massiv je höher der Blutdruck steigt. Eine regelmäßige Selbstmessung wird empfohlen, etwa 3-mal pro Woche zu unterschiedlichen Tageszeiten, die dann dokumentiert werden. So kann sich der Arzt ein genaues Bild über evtl. Schwankungen machen. Ursachen der Erkrankung sind meistens eine erbliche Anlage, Übergewicht oder auch Alkohol, seltener Nieren- oder Gefäßerkrankungen, hormonelle Erkrankungen, Medikamente oder auch Schlafstörungen. Eine Änderung des Lebensstils kann bei leicht erhöhtem Blutdruck so viel bewirken wie zwei Medikamente zusammen: Eine Beschränkung der Kochsalzzufuhr, Gewichtsabnahme, regelmäßige sportliche Aktivität, Einschränkung des Alkoholkonsums, Verzicht auf Rauchen und eine gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse, wenig Fleisch, Fett und Zucker. Ein Zuviel an Salz kann durch Kräuter und Gewürze ersetzt werden.
Bluthochdruck ist die Todesursache Nr. 1 in Deutschland, er ist jeweils für rd. die Hälfte der Herzinfarkte und Schlaganfälle verantwortlich. Eine Früherkennung und rechtzeitige Behandlung sind daher sehr wichtig, hob Dr. med. Christian Fechtrup, Münster, Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Angiologie, FESC in seinem Vortrag zum Thema „Bluthochdruck“ hervor. Fast jeder Dritte ist von Bluthochdruck betroffen, dieser ist aber gut behandelbar. Unbehandelt kann er zu schweren Folgen führen: Herzerkrankungen, Nierenerkrankungen, Schlaganfall, Hirnerweichung, Netzhautschaden oder gar Erblindung. Auch die Lebenserwartung sinkt massiv je höher der Blutdruck steigt. Eine regelmäßige Selbstmessung wird empfohlen, etwa 3-mal pro Woche zu unterschiedlichen Tageszeiten, die dann dokumentiert werden. So kann sich der Arzt ein genaues Bild über evtl. Schwankungen machen. Ursachen der Erkrankung sind meistens eine erbliche Anlage, Übergewicht oder auch Alkohol, seltener Nieren- oder Gefäßerkrankungen, hormonelle Erkrankungen, Medikamente oder auch Schlafstörungen. Eine Änderung des Lebensstils kann bei leicht erhöhtem Blutdruck so viel bewirken wie zwei Medikamente zusammen: Eine Beschränkung der Kochsalzzufuhr, Gewichtsabnahme, regelmäßige sportliche Aktivität, Einschränkung des Alkoholkonsums, Verzicht auf Rauchen und eine gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse, wenig Fleisch, Fett und Zucker. Ein Zuviel an Salz kann durch Kräuter und Gewürze ersetzt werden.
→ Dr. med. Fechtrup: Bluthochdruck – Bedeutung & Erkennung
(Powerpointpräsentation, 49 Seiten, PDF, 19 MB)
Prof. Dr. Greulich: Möglichkeiten und Grenzen der medikamentösen Parkinsontherapie
 Prof. Dr. Wolfgang Greulich, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Geriatrie und Ärztlicher Direktor i.R. der HELIOS Klinik Hagen-Ambrock, berichtete über die Anfänge der L-Dopa Therapie bei Patienten, die sich aus dem Liegen nicht aufrichten, aus dem Sitzen nicht aufstehen und vom Stehen nicht zum Gehen starten konnten, und diese Bewegungen dadurch wieder möglich wurden. Da die Krankheit jedoch mit den Jahren fortschreitet und durch die Erhöhung der Medikamente Nebenwirkungen, wie motorische Störungen und Gleichgewichtsstörungen mit Sturzgefahr sowie Halluzinationen auftreten können, müssen Neueinstellungen der Medikamente beim Patienten vorgenommen werden. Bei der Therapie mit Dopaminagonisten kann es, besonders bei jüngeren Patienten, zu einer Impulskontroll-Störung, wie Spielsucht, Kaufrausch, Essattacken oder gesteigertem Sexualantrieb kommen. Durch die Veränderung der Medikation können diese Störungen behandelt werden, wobei Prof. Dr. Greulich auch die Grenzen der medikamentösen Behandlung betrachtet.
Prof. Dr. Wolfgang Greulich, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Geriatrie und Ärztlicher Direktor i.R. der HELIOS Klinik Hagen-Ambrock, berichtete über die Anfänge der L-Dopa Therapie bei Patienten, die sich aus dem Liegen nicht aufrichten, aus dem Sitzen nicht aufstehen und vom Stehen nicht zum Gehen starten konnten, und diese Bewegungen dadurch wieder möglich wurden. Da die Krankheit jedoch mit den Jahren fortschreitet und durch die Erhöhung der Medikamente Nebenwirkungen, wie motorische Störungen und Gleichgewichtsstörungen mit Sturzgefahr sowie Halluzinationen auftreten können, müssen Neueinstellungen der Medikamente beim Patienten vorgenommen werden. Bei der Therapie mit Dopaminagonisten kann es, besonders bei jüngeren Patienten, zu einer Impulskontroll-Störung, wie Spielsucht, Kaufrausch, Essattacken oder gesteigertem Sexualantrieb kommen. Durch die Veränderung der Medikation können diese Störungen behandelt werden, wobei Prof. Dr. Greulich auch die Grenzen der medikamentösen Behandlung betrachtet.
→ Prof. Dr. Greulich: Möglichkeiten und Grenzen der medikamentösen Parkinson-Therapie
(Powerpointpräsentation, 46 Seiten, PDF, 3.2 MB)